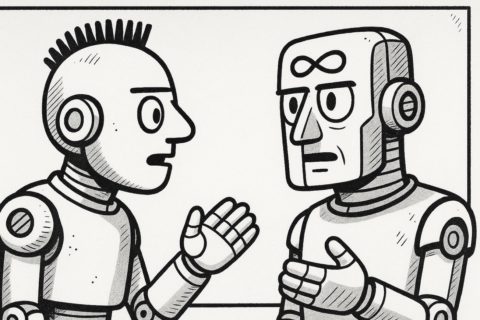Die Struktur der Sprache alaju lässt sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum Beipiel aus Sicht der Quantenmechanik, des Taoismus, der Philosophie Whiteheads oder anderer. Dabei wird eines schnell klar: Betrachtet man alaju aus der einen oder anderen Sicht, verschwimmen die Resultate anderer Betrachtungen. Das rührt daher, dass alaju als Sprache nicht Zustände erklärt, sondern Prozesse veranschaulicht, ohne diese jedoch genau zu erklären ¹. Die Betrachtung eines Prozesses verändert sich mit den Brachtenden und der jeweiligen Umgebung. Man kann tatsächlich sagen: Alaju ist in seiner Grundstruktur näher an einer quantenmechanischen Prozesslogik als an der Logik klassische-aristotelischer Begriffsdefinitionen.
Während klassische europäische Sprachen in der Regel von fixierten Zuständen ausgehen, also versuchen eine Absolute zu definieren, beschreibt Alaju vor allem Prozesse, Übergänge und Relationen. Wörter wie amun (Sein), ar (Dazwischen) oder be (Möglichkeit) verweisen auf Ereignisfelder, die sich jeweils nur im konkreten Handeln zeigen.
Diese Ereignisfelder werden gadho (Sammlung) genannt, in der Akteure zusammenkommen und durch ihre Interaktion Bedeutung erzeugen. In dieser relationalen Konstellation, vergleichbar mit dem Messprozess in der Quantenmechanik wie sie Heisenberg beschreibt, und bei der Teilchen in Wechselwirkung mit Messapparatur, Feld und Umgebung stehen, kollabieren die semantischen Superpositionen der Wörter zu bestimmten Lesarten die abhängig von den Beobachtenden, Handelnden und vom Umfeld sind.
Für das alaju bedeutet dies: Je genauer man ein Wort wie amun festlegen möchte, desto stärker entgleitet sein prozesshafter Charakter. Man könnte sagen: Das amun, das du erklären kannst, ist nicht das amun. Diese Formulierung erinnert bewusst an Laotzi: «Der Dao, der benannt werden kann, ist nicht der ewige Dao.» [alaju:den·tao·ike·tent;ne·aju·tao·ieh:]. Sowohl in der Quantenphysik als auch im Taoismus wird deutlich, dass der Versuch der begrifflichen Fixierung an eine Grenze stößt: Wirklichkeit zeigt sich nicht als Zustand, sondern als Ereignis.
alaju gibt dieser Dynamik eine sprachliche Form die erst im gadho, in der konkreten Sammlung von Akteuren und Bedeutungsfeldern, gewinnt jedes dieser Wörter eine situative Gestalt. Damit eröffnet Alaju ein Sprachmodell, das nicht beschreibt was ist oder existiert, sondern vielmehr das was geschieht: ein System, das nicht festlegt, wie Dinge sind, sondern das Erleben und den Ablauf von Vorgängen möglich macht. ein System, das nicht Dinge fixiert, sondern Prozesse erfahrbar macht.Betrachten wir, um ein konkretes Beispiel zu haben, das alaju-Wort ani «wir»
Die «wir»-Auffassung in der Nienetwiler Kultur unterscheidet sich radikal von der der meisten anderen Kulturen. Wo sich manche Volksgruppen über den Ausschluss anderer definieren, oder über ihre angeblich «rassische» Zugehörigkeit, über ihre Religion, Uniform oder ihre kulturellen Gemeinsamkeiten, ist dies alles in der Nienetwiler Kultur inexistent.
«Wir» ist immer temporärer Natur und bezieht sich ausschliesslich auf einen vorübergehenden, gemeinsamen Handlungsraum, bzw. Sammlung gadho. Wir arbeiten gemeinsam an etwas und in dieser Zeit des gepa, des gemeinsamen Handelns, ist «wir» ein Begriff der alle Akteure miteinschliesst. Ohne gadho also kein ani.
Hinzu kommt, dass dieses «wir» von aussen nicht betrachtet werden kann, da es kein Zustand (Teilchen), sondern eben Prozess (Wellenform) ist. Das Bestimmen der Superposition des «wir» ist also zwar möglich, erlaubt aber keine genaue Analyse, da man dazu selber Teil der Sammlung werden müsste. Denn im Gegensatz zu jemandem der nicht «wir» ist, aktualisieren die Sammlungsbeteiligten durch das gemeinsame Handeln und den Fluss von Information regelmässig ihren Standort im Handlungsraum.
1 ausser sie macht gerade das genaue Gegenteil
Simon smy Meyer, 2025